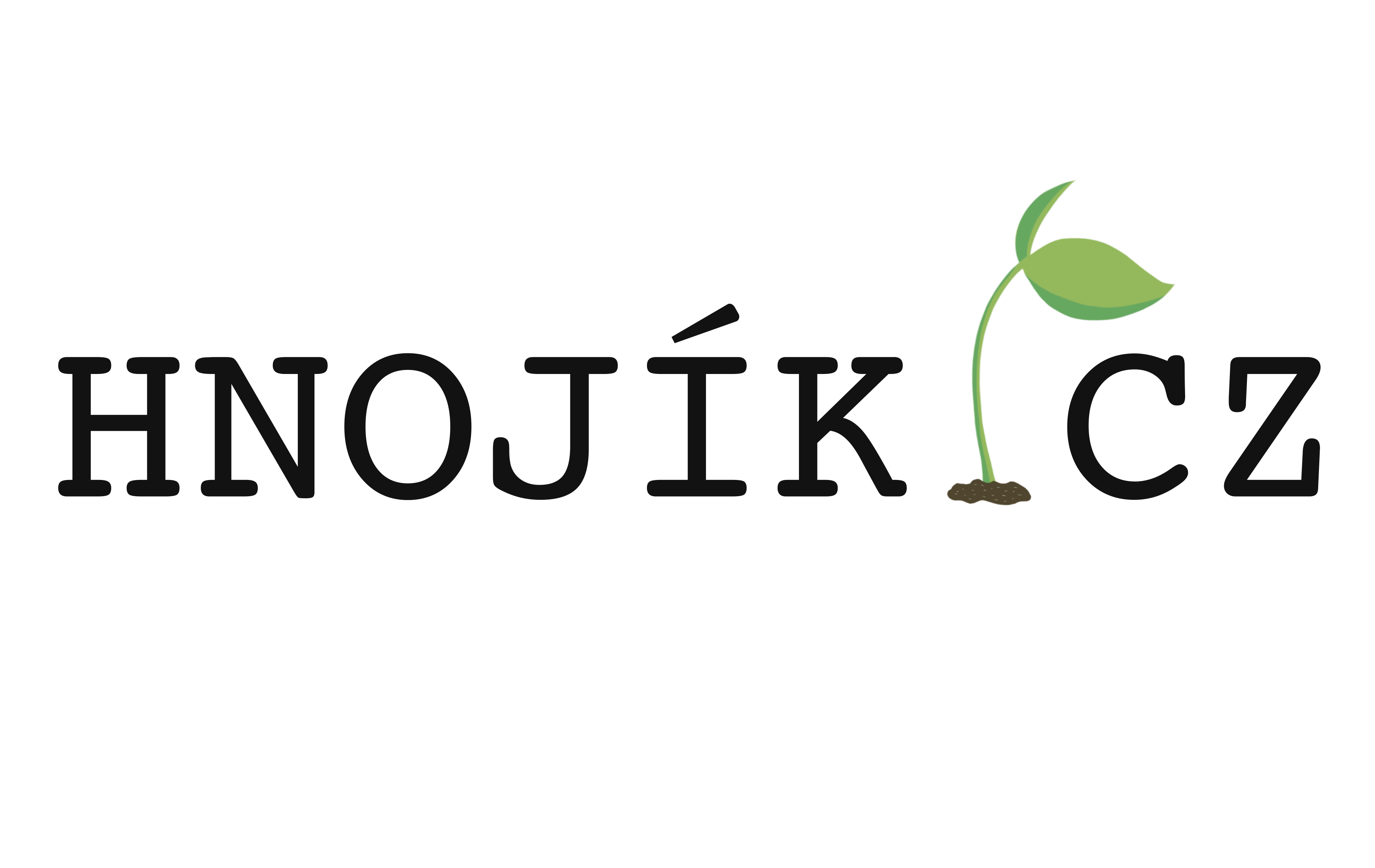Dosierung
Holen Sie sich Informationen zur richtigen Dosierung des Düngees Düngee für verschiedene Pflanzen. Wenden Sie es als Streu, Gießen oder Sprühung an, um optimales Wachstum und Schutz vor Schädlingen zu gewährleisten.

Perfekter natürlicher Dünger mit abweisender Wirkung auf Schädlinge und Pflanzenkrankheiten. Sie werden es lieben.
ab 6.20 €auf Lager
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Haut von Mehlwürmern mit Chitin zur Verstärkung der abweisenden Wirkung auf Schädlinge und Pflanzenkrankheiten.
9.55 €4 auf Lager
In den Warenkorb
Perfekter natürlicher Dünger mit abweisender Wirkung auf Schädlinge und Pflanzenkrankheiten. Sie werden es lieben.
ab 14.36 €auf Lager
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Perfekter Dünger mit abwehrender Wirkung gegen Schädlinge und Pflanzenkrankheiten. Das ganze Jahr über für 200m² 🌱 Garten. Sie werden es lieben.
ab 52.00 €auf Lager
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Perfekter Dünger mit abwehrender Wirkung gegen Schädlinge und Pflanzenkrankheiten. Das ganze Jahr über für 320m² 🌱 Garten. Sie werden es lieben.
ab 74.00 €auf Lager
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Perfekter Dünger mit abwehrender Wirkung gegen Schädlinge und Pflanzenkrankheiten. Das ganze Jahr über für 500m² 🌱 Garten. Sie werden es lieben.
ab 95.68 €auf Lager
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Perfekter natürlicher Dünger mit abweisender Wirkung auf Schädlinge und Pflanzenkrankheiten. Sie werden es lieben.
11.54 €1 auf Lager
In den Warenkorb
Perfekter natürlicher Dünger mit abweisender Wirkung auf Schädlinge und Pflanzenkrankheiten. Sie werden es lieben.
11.54 €3 auf Lager
In den Warenkorb
Perfekter natürlicher Dünger mit abweisender Wirkung auf Schädlinge und Pflanzenkrankheiten. Sie werden es lieben.
11.54 €1 auf Lager
In den Warenkorb
Filter aus 100 Mikron Nylon. Größe: 24*15 cm Durchmesser: 11 cm Gewicht: 50 g
4.26 €auf Lager
In den Warenkorb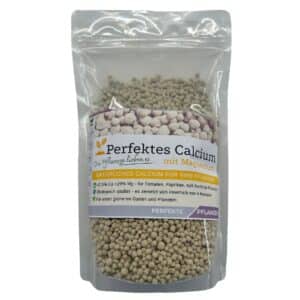
Kalk für den Boden auf Kreidebasis. Zersetzung innerhalb von 4 Monaten nach der Anwendung.
4.60 €auf Lager
In den Warenkorb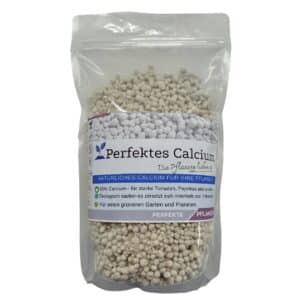
Kalk für den Boden auf Kreidebasis. Zersetzung innerhalb von 2 Monaten nach der Anwendung.
4.60 €auf Lager
In den Warenkorb
USB-Belüftung zum Auslaugen von Düngee
4.60 €auf Lager
In den Warenkorb
Die praktische Verpackung von zerkleinertem Biochar ist ein natürlicher Booster für Ihren Boden. Es lockert den Boden, verbessert seine Struktur, speichert Wasser und fördert die Vermehrung und Entwicklung des Bodenlebens.
6.28 €auf Lager
In den Warenkorb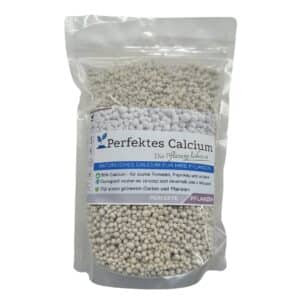
Kalk für den Boden auf Kreidebasis. Zersetzung innerhalb von 2 Monaten nach der Anwendung.
6.58 €auf Lager
In den Warenkorb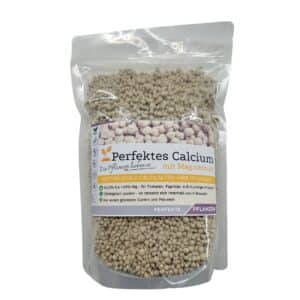
Kalk für den Boden auf Kreidebasis. Zersetzung innerhalb von 4 Monaten nach der Anwendung.
6.58 €auf Lager
In den Warenkorb
Die praktische Verpackung von zerkleinertem Biochar ist ein natürlicher Booster für Ihren Boden. Es lockert den Boden, verbessert seine Struktur, speichert Wasser und fördert die Vermehrung und Entwicklung des Bodenlebens.
11.24 €nicht auf Lager
Weiterlesen
Calcium für den Boden auf Kreidebasis. Zersetzung innerhalb von 2 Monaten nach der Anwendung.
19.80 €auf Lager
In den Warenkorb
Kalk für den Boden auf Kreidebasis. Zersetzung innerhalb von 4 Monaten nach der Anwendung.
19.80 €auf Lager
In den Warenkorb
Filter aus 100 Mikron Nylon. Größe: 24*15 cm Durchmesser: 11 cm Gewicht: 50 g
4.26 €auf Lager
In den Warenkorb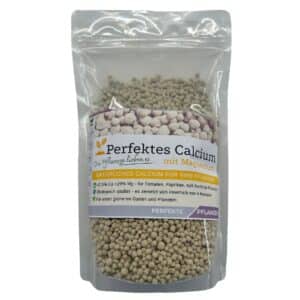
Kalk für den Boden auf Kreidebasis. Zersetzung innerhalb von 4 Monaten nach der Anwendung.
4.60 €auf Lager
In den Warenkorb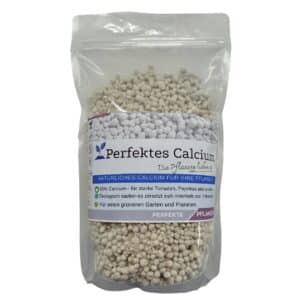
Kalk für den Boden auf Kreidebasis. Zersetzung innerhalb von 2 Monaten nach der Anwendung.
4.60 €auf Lager
In den Warenkorb
USB-Belüftung zum Auslaugen von Düngee
4.60 €auf Lager
In den Warenkorb
Perfekter natürlicher Dünger mit abweisender Wirkung auf Schädlinge und Pflanzenkrankheiten. Sie werden es lieben.
ab 6.20 €auf Lager
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Die praktische Verpackung von zerkleinertem Biochar ist ein natürlicher Booster für Ihren Boden. Es lockert den Boden, verbessert seine Struktur, speichert Wasser und fördert die Vermehrung und Entwicklung des Bodenlebens.
6.28 €auf Lager
In den Warenkorb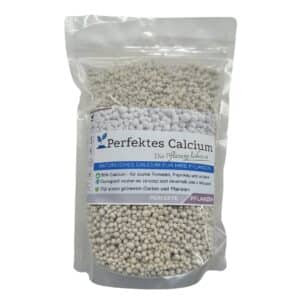
Kalk für den Boden auf Kreidebasis. Zersetzung innerhalb von 2 Monaten nach der Anwendung.
6.58 €auf Lager
In den Warenkorb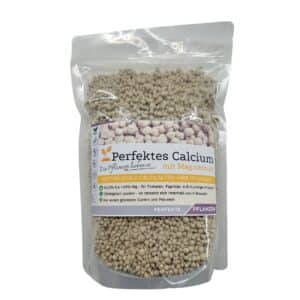
Kalk für den Boden auf Kreidebasis. Zersetzung innerhalb von 4 Monaten nach der Anwendung.
6.58 €auf Lager
In den Warenkorb
Haut von Mehlwürmern mit Chitin zur Verstärkung der abweisenden Wirkung auf Schädlinge und Pflanzenkrankheiten.
9.55 €4 auf Lager
In den Warenkorb
Die praktische Verpackung von zerkleinertem Biochar ist ein natürlicher Booster für Ihren Boden. Es lockert den Boden, verbessert seine Struktur, speichert Wasser und fördert die Vermehrung und Entwicklung des Bodenlebens.
11.24 €nicht auf Lager
Weiterlesen
Perfekter natürlicher Dünger mit abweisender Wirkung auf Schädlinge und Pflanzenkrankheiten. Sie werden es lieben.
11.54 €1 auf Lager
In den Warenkorb
Perfekter natürlicher Dünger mit abweisender Wirkung auf Schädlinge und Pflanzenkrankheiten. Sie werden es lieben.
11.54 €3 auf Lager
In den Warenkorb
Perfekter natürlicher Dünger mit abweisender Wirkung auf Schädlinge und Pflanzenkrankheiten. Sie werden es lieben.
11.54 €1 auf Lager
In den Warenkorb
Perfekter natürlicher Dünger mit abweisender Wirkung auf Schädlinge und Pflanzenkrankheiten. Sie werden es lieben.
ab 14.36 €auf Lager
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Calcium für den Boden auf Kreidebasis. Zersetzung innerhalb von 2 Monaten nach der Anwendung.
19.80 €auf Lager
In den Warenkorb
Kalk für den Boden auf Kreidebasis. Zersetzung innerhalb von 4 Monaten nach der Anwendung.
19.80 €auf Lager
In den Warenkorb
Perfekter Dünger mit abwehrender Wirkung gegen Schädlinge und Pflanzenkrankheiten. Das ganze Jahr über für 200m² 🌱 Garten. Sie werden es lieben.
ab 52.00 €auf Lager
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Perfekter Dünger mit abwehrender Wirkung gegen Schädlinge und Pflanzenkrankheiten. Das ganze Jahr über für 320m² 🌱 Garten. Sie werden es lieben.
ab 74.00 €auf Lager
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Perfekter Dünger mit abwehrender Wirkung gegen Schädlinge und Pflanzenkrankheiten. Das ganze Jahr über für 500m² 🌱 Garten. Sie werden es lieben.
ab 95.68 €auf Lager
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Filter aus 100 Mikron Nylon. Größe: 24*15 cm Durchmesser: 11 cm Gewicht: 50 g
4.26 €auf Lager
In den Warenkorb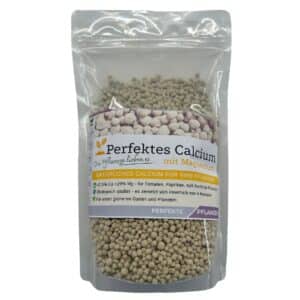
Kalk für den Boden auf Kreidebasis. Zersetzung innerhalb von 4 Monaten nach der Anwendung.
4.60 €auf Lager
In den Warenkorb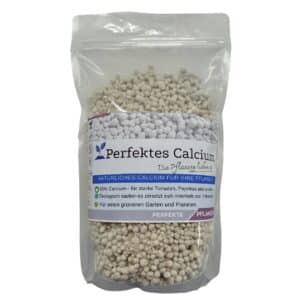
Kalk für den Boden auf Kreidebasis. Zersetzung innerhalb von 2 Monaten nach der Anwendung.
4.60 €auf Lager
In den Warenkorb
USB-Belüftung zum Auslaugen von Düngee
4.60 €auf Lager
In den Warenkorb
Perfekter natürlicher Dünger mit abweisender Wirkung auf Schädlinge und Pflanzenkrankheiten. Sie werden es lieben.
ab 6.20 €auf Lager
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Die praktische Verpackung von zerkleinertem Biochar ist ein natürlicher Booster für Ihren Boden. Es lockert den Boden, verbessert seine Struktur, speichert Wasser und fördert die Vermehrung und Entwicklung des Bodenlebens.
6.28 €auf Lager
In den Warenkorb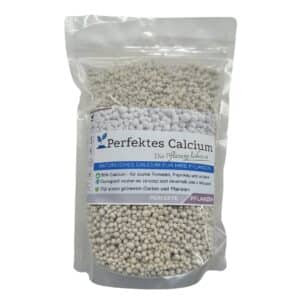
Kalk für den Boden auf Kreidebasis. Zersetzung innerhalb von 2 Monaten nach der Anwendung.
6.58 €auf Lager
In den Warenkorb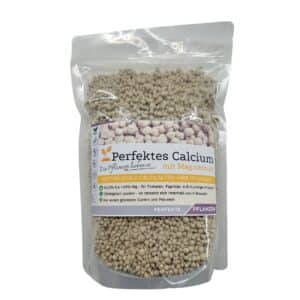
Kalk für den Boden auf Kreidebasis. Zersetzung innerhalb von 4 Monaten nach der Anwendung.
6.58 €auf Lager
In den Warenkorb
Haut von Mehlwürmern mit Chitin zur Verstärkung der abweisenden Wirkung auf Schädlinge und Pflanzenkrankheiten.
9.55 €4 auf Lager
In den Warenkorb
Die praktische Verpackung von zerkleinertem Biochar ist ein natürlicher Booster für Ihren Boden. Es lockert den Boden, verbessert seine Struktur, speichert Wasser und fördert die Vermehrung und Entwicklung des Bodenlebens.
11.24 €nicht auf Lager
Weiterlesen
Perfekter natürlicher Dünger mit abweisender Wirkung auf Schädlinge und Pflanzenkrankheiten. Sie werden es lieben.
11.54 €1 auf Lager
In den Warenkorb
Perfekter natürlicher Dünger mit abweisender Wirkung auf Schädlinge und Pflanzenkrankheiten. Sie werden es lieben.
11.54 €3 auf Lager
In den Warenkorb
Perfekter natürlicher Dünger mit abweisender Wirkung auf Schädlinge und Pflanzenkrankheiten. Sie werden es lieben.
11.54 €1 auf Lager
In den Warenkorb
Perfekter natürlicher Dünger mit abweisender Wirkung auf Schädlinge und Pflanzenkrankheiten. Sie werden es lieben.
ab 14.36 €auf Lager
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Calcium für den Boden auf Kreidebasis. Zersetzung innerhalb von 2 Monaten nach der Anwendung.
19.80 €auf Lager
In den Warenkorb
Kalk für den Boden auf Kreidebasis. Zersetzung innerhalb von 4 Monaten nach der Anwendung.
19.80 €auf Lager
In den Warenkorb
Perfekter Dünger mit abwehrender Wirkung gegen Schädlinge und Pflanzenkrankheiten. Das ganze Jahr über für 200m² 🌱 Garten. Sie werden es lieben.
ab 52.00 €auf Lager
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Perfekter Dünger mit abwehrender Wirkung gegen Schädlinge und Pflanzenkrankheiten. Das ganze Jahr über für 320m² 🌱 Garten. Sie werden es lieben.
ab 74.00 €auf Lager
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Perfekter Dünger mit abwehrender Wirkung gegen Schädlinge und Pflanzenkrankheiten. Das ganze Jahr über für 500m² 🌱 Garten. Sie werden es lieben.
ab 95.68 €auf Lager
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Holen Sie sich Informationen zur richtigen Dosierung des Düngees Düngee für verschiedene Pflanzen. Wenden Sie es als Streu, Gießen oder Sprühung an, um optimales Wachstum und Schutz vor Schädlingen zu gewährleisten.